von Lea Schön | Illustrationen von Johannes Schröder
Reisen ist das Statussymbol unserer Generation. Ständig befreien wir mehr Erdfläche auf unseren Rubbel-Weltkarten aus der grauen Bedeutungslosigkeit unserer Unkenntnis. Gespräche beginnen nicht selten mit einem Schlagabtausch darüber, wer schon wo überall war und wie inspirierend und bereichernd und lebensverändernd diese Zeit gewesen sei. Weiter, Öfter, Länger. Immer gewinnt eine*r diesen Kampf. Zwar knapp, aber jemand gewinnt.
Der globale Süden ist dabei die Altbauwohnung im Stadtzentrum unter den Reisezielen. Alle Semesterferien wieder packt ein*e Studierende*r seinen höchstens 21 Kilo schweren Rucksack und fliegt viele Kilometer weit weg nach Nepal oder Indonesien oder Brasilien. Wir bleiben dort für einen Monat oder zwei und möchten die Kultur und tolle Menschen kennenlernen – uns selbst finden.
Der Hass auf Kreuzfahrende ist in der Mitte angekommen. (Fast) alle können sich darauf einigen wie überflüssig diese Form des Reisens ist. Pauschalreisende werden wie selbstverständlich als erbärmlich abgestempelt. Flüge, egal wie lang oder kurz, sind nicht tragbar – vor allem dann nicht, wenn man sowieso nur irgendwo träge am Strand liegt. Soweit so gut. Wir hingegen sammeln Erfahrungen, das ist unserer Rechtfertigung dafür, mit 21 Jahren fleißig Flugmeilen anzuhäufen. Wir legen 11.000 Kilometer nach Bali zurück und pusten 4,5 Tonnen CO2 in die Luft. Aber dafür schmeckt das Curry besonders lecker und die Ananas einfach so viel besser als in Deutschland.
Mit einem möglichst kleinen Budget ziehen wir los in die weite Welt und möchten Freund*innen fürs Lebens finden. „Die Welt ist ein Buch und diejenigen welche nicht reisen, lesen nur eine Seite“, schreiben wir unter unseren nächsten Instagrampost. In unserer privilegierten Position einen deutschen Pass zu besitzen, möchten wir einfach leben – alternativ, offen und frei sein. Wir buchen unsere Hostels spontan, holen Streetfood bei der*dem Verkäufer*in unseres Vertrauens und lassen uns einfach treiben. Wir sind nie länger als zwei Nächte an einem Ort, machen einen Surfkurs hier, Party dort und freuen uns über das Geld, das wir beim Verhandeln für das Taxi gespart haben. Wir lernen Marc from Canada und Sophie from Australia kennen. Die treffen wir dann zufällig auch beim Tauchkurs eine Woche später wieder – such a small world. Vier Wochen später haben wir uns selbst gefunden, also fast. Die Bucketlist hat einen Haken mehr und wir so richtig viele Geschichten zu erzählen.
Selten erntet diese Art des Reisens Kritik. Denn Backpacken passiert unter dem Deckmantel der Bescheidenheit, dem Motto der Authentizität und – bei kurzfristiger Verdrängung der Klimakrise – sogar unter dem Vorwand der Nachhaltigkeit. Wir kämpfen schließlich gegen die Aufrechterhaltung von Stereotypen, wir überwinden Grenzen. Wir begeben uns scheinbar aus unserer Blase und leben freiwillig für einen Monat ganz rudimentär, ohne sauberes Trinkwasser, aber fast immer mit Internet. Eigentlich aber fliegen wir uns in eine Parallelwelt, sind Beobachter*innen von außen, machen Urlaub im Irgendwo und fühlen uns dabei besonders. Das Problem ist, dass die Privilegien von uns reichen Europäer*innen mit einer solchen Reise in den globalen Süden tausend Mal unterstrichen werden. Als junge Menschen, die ständig beteuern wie wenig Geld sie haben und dennoch jeden Abend an der Strandbar ein Bier nach dem Anderen hinunterkippen, befeuern wir ein Machtgefälle, das vielleicht in einer anderen Welt ohne (Post-)Kolonialismus einfach so überwunden werden könnte. „Aber die Menschen sind ja so glücklich, obwohl sie so wenig haben“ – erzählen wir unseren besorgten Eltern am Telefon.
Wir haben uns oberflächlich mit dem Phänomen der interkulturellen Kommunikation beschäftigt, trotzdem fühlen wir uns vor den Kopf gestoßen, wenn nicht alles nach Plan funktioniert. Die Gründe warum Dinge anders sind, lassen sich am besten kennenlernen, wenn man sich mit Menschen unterhält. Die Sprachen eines Landes zu sprechen ist allerdings – anders als eine Gelbfieberimpfumg – keine Notwendigkeit, um einreisen zu dürfen. So bleiben tiefergehende Formen der Kommunikation aus. Es findet kein Austausch über politische Systeme oder zivilgesellschaftliche Phänomene, wichtige und unwichtige Dinge im Leben statt. Stattdessen diskutieren wir mit Emma from England über europäische Außenpolitik, während wir auf Plastikhockern sitzen und versuchen das Hähnchen aus der „vegetarischen“ Version unserer Nudelsuppe zu picken.
Das heißt nicht, dass es besser ist, sich abzuschotten oder zu isolieren. Eine offene Gesellschaft kann nur über Erfahrungsaustausch entstehen. Gnadenlos die Prämisse der Ungleichheit zu ignorieren darf allerdings auch keine Lösung sein. Vielleicht können wir die tollen Menschen mit beeindruckenden Ideen und unterschiedlicher Sozialisierung trotzdem treffen. Vielleicht sogar direkt vor unserer Nase.
Also lass uns doch auch mal zu Hause bleiben. Vielleicht einfach im Erzgebirge wandern gehen. Oder die Wohnung zum Hotspot des Couchsurfings machen. Aber lass uns damit aufhören, unseren Pass voller Möglichkeiten jedem unter die Nase zu halten.

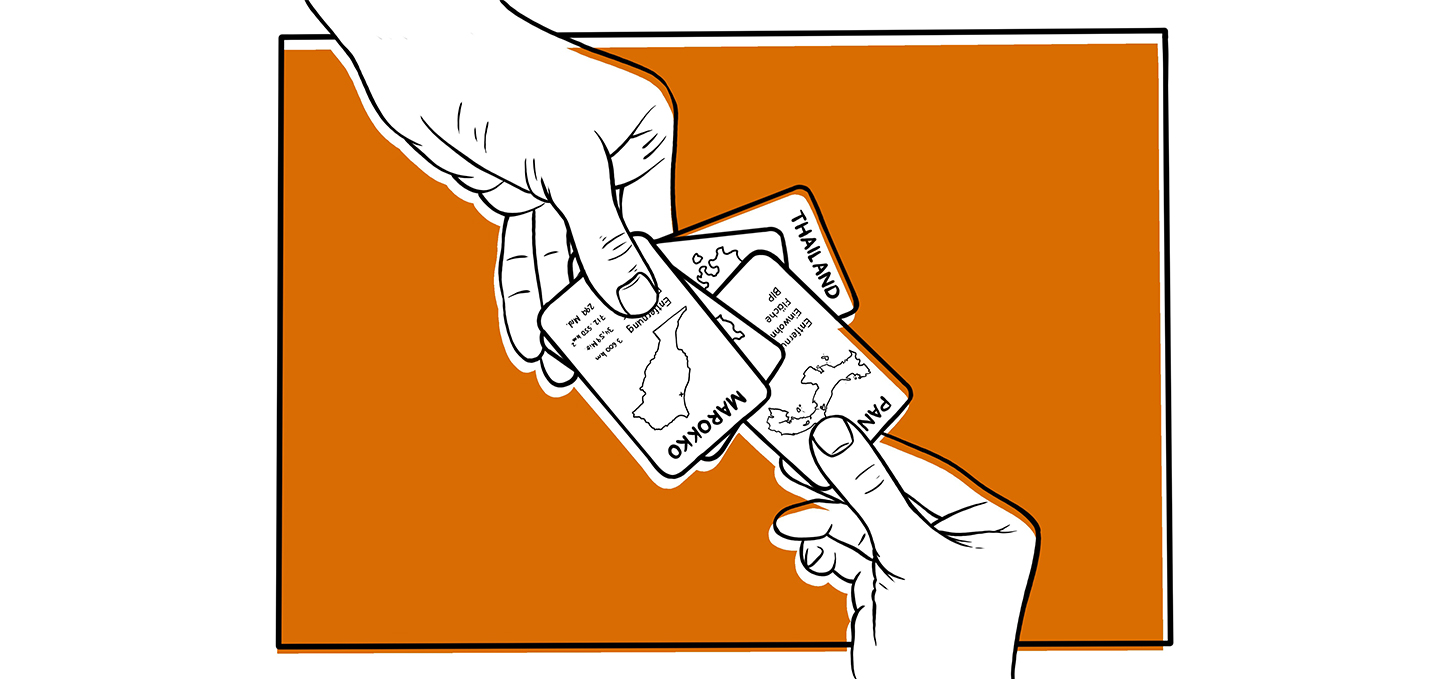

Ein sehr schöner und wichtiger Beitrag in einer Zeit, in der unsere Generation einem ‚Imperativ der Mobilität‘ zu unterliegen scheint.
„Reisen vollziehen sich im Innern, und die gewagtesten – überflüssig, es zu sagen – werden vollbracht, ohne dass man sich sich von der Stelle rührt.“ (Henry Miller)