Von Friederike Schick | Kunst: © Shirin Krastel
Wenn ich am Abend vor Weihnachten zu meinen Eltern nach Hause komme, dann ist das ein anderes nach Hause kommen als die unzähligen Male zuvor im Jahr. Dann streife ich das erwachsene Ich ab und schlüpfe kurz wieder in den kleinen Körper meiner Kindheit. Denn an Weihnachten nach Hause zu kommen ist das Gefühl, kurz in die heile Kinderwelt zurückzukehren. Für einen Abend wieder an Zauber und Wunder zu glauben und mit leuchtenden Augen vor dem Tannenbaum zu stehen. Ein Text als (Liebes-)Erklärung, warum Weihnachten ein Gefühl ist.
Jahresendspurt
Advent (lat. adventus) bedeutet Ankunft. Aus christlicher Sicht ist damit die Ankunft des Herrn gemeint. In der Adventszeit bereiten sich Christ:innen auf die Ankunft, die Geburt von Jesus Christus, vor. Aber man muss dieses „Ankommen“ nicht zwangsläufig christlich lesen. Die Adventszeit kann ein Ankommen auf viele verschiedene Arten und Weisen sein. Am Ende des Jahres sage ich oft, dass ich das Gefühl habe, dass das Jahr nochmal Fahrt aufnimmt. Es fühlt sich so an, als würden wir den Dezember immer schneller bergab rennen. Schneller und schneller noch Geschenke besorgen oder am besten selbst basteln, es soll ja schließlich auch was Persönliches sein. Vor den Geschenken noch schnell Weihnachtspost an alle Freund:innen verschicken und bloß nicht das Plätzchenbacken vergessen, für die Weihnachtsstimmung und so. Nebenher muss der Alltag, der sonst in vier Wochen passt, in drei Wochen gequetscht werden, denn ab Heiligabend ist das Jahr irgendwie ja auch schon zu Ende. Immer schneller und schneller rennen wir also bergab, nehmen immer mehr Fahrt auf, bis wir uns fast überschlagen.
Wenn wir nicht stehen bleiben, können wir nicht ankommen
Dabei wird die Adventszeit dann eher zur Stresszeit. Die Duden-Definition von Ankommen lautet: „einen Ort erreichen, an einem Ort eintreffen“. Wenn wir aber immer weiter rennen und rennen, können wir niemals ankommen. Dafür müssten wir schon einmal stehen bleiben. Für mich ist die Zeit im Advent eine besondere, eben weil Zeit da ist oder eher: weil ich sie mir nehme. Weil ich mir erlaube, stehen zu bleiben und anzukommen – bei mir. Weihnachten bedeutet für mich, auch in mir anzukommen. Es ist das Kerzenleuchten am frühen Morgen, das als erstes sein Licht in den noch nicht angebrochenen Tag bringt. Im Übergang zwischen Nacht und Tag ist da ein Moment, den ich nur für mich habe.

Das Daumenkino der Kindheit
Dieses Jahr habe ich einige Menschen gefragt, was Weihnachten für sie bedeutet und alle, wirklich alle, haben von ihrer Kindheit erzählt. Weihnachten bedeutet somit tatsächlich jedes Jahr aufs Neue die Ankunft eines Kindes. Es ist die Ankunft unseres eigenen inneren Kindes. An Weihnachten reihen sich Kindheitserinnerungen so dicht aneinander, dass all die Fragmente ein Gesamtbild unseres Kindheitsgefühls ergeben, in welches wir für eine Weile wiedereintauchen können. So wie ein Daumenkino, das aus vielen einzelnen Bildern einen bewegten Film entstehen lässt, gerät unsere Kindheit durch die vielen aneinandergereihten Weihnachtserinnerungen wieder in Bewegung.
Dann sind mein Bruder und ich wieder fünf Jahre alt, wenn wir am Weihnachtsmorgen gemeinsam unter die Bettdecke gekuschelt Michel aus Lönneberga und Pippi Langstrumpf gucken. Wir – meine Eltern, meine Großmutter, mein Bruder und ich – sind alle wieder Kinder, wenn wir am Abend mit golden leuchtenden Augen vor dem Honigkerzenschein des Tannenbaums stehen und uns beschenken.
„Als würde das Jahr selbst kurz andächtig innehalten“
In diesem Moment bleibt die Zeit kurz stehen und nur das Weihnachtsoratorium spielt noch. In diesem Moment hören wir alle endlich auf zu rennen. Es ist, als würde das Jahr selbst kurz andächtig innehalten und vergessen, dass es noch eine Woche weiterlaufen muss. In diesem Moment gibt es keine Zeitdimension mehr. Dann stehen mein Bruder und ich mit Mitte zwanzig vor dem Tannenbaum und sind zugleich die kleinen Kinder, die angespannt durch das Kinderzimmerfenster in die Dunkelheit starren und nach dem Leuchten des Christkindes Ausschau halten. Vor uns schimmert ein Teelicht durch eine Weihnachtsmannfigur aus rotem Glas. Es sieht ein bisschen so aus, als würde Licht durch ein Kirchenfenster fallen. Dort sitzen wir in der Dunkelheit des Kinderzimmers, singen Weihnachtslieder und rücken das Kirchenglas-Teelicht noch ein bisschen dichter ans Fenster, damit uns das Christkind gut finden kann. Unsere Blicke gehen zwar nach draußen, aber unsere Ohren lauschen angestrengt auf das helle Klingeln der Glocke aus dem Wohnzimmer. Dann würden wir die Treppe hinunterstürmen und ins Weihnachtsleuchten treten, denn dann war das Christkind da.
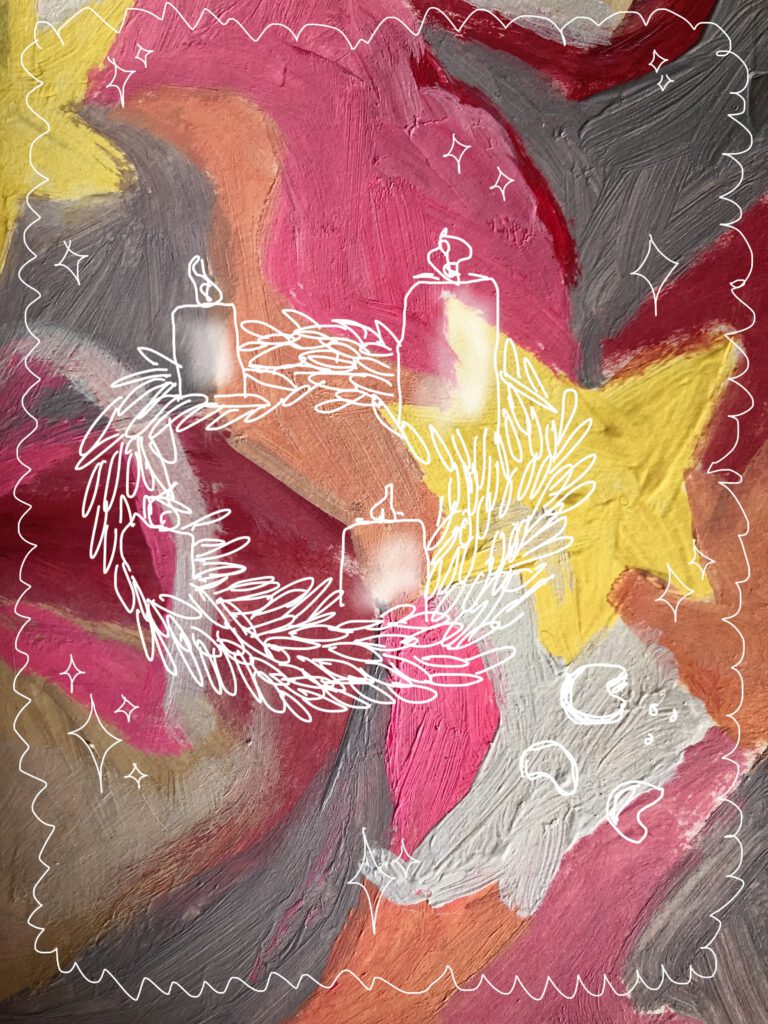
Besinnlichkeitskrumen und warme Gemütlichkeit
Mein Papa kann heute vor dem Tannenbaum stehen, auf seine erwachsenen Kinder blicken und sich zugleich wieder wie der kleine Junge fühlen, der einst das Christkind sah. Wie oft hat er uns diese Geschichte erzählt. Und wie oft habe ich nur deswegen so angestrengt in die Dunkelheit hinausgeblickt, um den gleichen Goldschimmer zwischen den Baumkronen fliegen zu sehen. In diesem Stillstandsmoment am Weihnachtsbaum ist er der kleine Junge der Vergangenheit, der vom Weihnachtstisch aufspringt, weil er ein Rumpeln im Treppenhaus gehört hat. Er erinnert sich, dass die Treppe hinauf zur Wohnungstür mit Teppichboden ausgelegt war, der alle geräuschvollen Schritte dumpf verschluckte, und trotzdem hatte er dieses Geräusch nicht überhört. Der kleine Junge öffnet die Wohnungstür zur Treppe und blickt einem hell fliegenden Goldschimmer entgegen, welcher ihn mit dem nächsten Wimpernschlag wieder allein auf dem dunklen Treppenabsatz zurück und seitdem an den Geist der Weihnacht glauben lässt. So steht er vor dem Weihnachtsbaum, Vater und Kind zugleich.
Auch meine Mama erinnert sich an die Adventszeit ihrer Kindheit, die erst durch das Wirken meiner Großmutter diesen Hauch von Festlichkeit bekam. Denn meine Großmutter war schon immer die warme Gemütlichkeit der Familie. So erinnert sich meine Mama bei dem Gedanken an Weihnachten, an die von meiner Großmutter mit Tannengrün dekorierte Wohnung und ihre selbst gebackenen Vanillekipferl, deren Geruch durchs Haus zieht und die noch heute nach vanillezuckersüßen Besinnlichkeitskrumen schmecken. Sie hört das Knistern der Schallplatten, von denen die altbekannten Weihnachtslieder erklingen und das zarte Summen ihrer Mutter dazu. Und auch meine Großmutter sitzt für einen Augenblick wieder als junges Mädchen mit ihren Schwestern beim Weihnachtsessen, bei dem ihr Vater auf einmal beginnt, sie alle mit Milchsuppe zu bespritzen und sich die Härte des Lebens für einen Moment in Lachen auflöst.

„Weil wir alle ein bisschen das Leuchten füreinander sein können“
„Weihnachten ist ein Gefühl“, sagt mein Papa zu mir, als ich meine Familie danach frage, was Weihnachten für sie bedeutet. Ich muss schmunzeln, weil das schon vor seiner Antwort der Titel dieses Textes war. Es ist ein Gefühl, weil wir alle wissen, wie es sich anfühlt, Kind zu sein. Weil wir uns alle ab und an dahin zurücksehnen, wieder ein geheimnisvolles Leuchten in der Dunkelheit zu sehen. Es ist das Gefühl, nach all dem anstrengenden Auf und Ab des Jahres endlich innehalten und ankommen zu dürfen. Zurückzukommen in Wärme und Geborgenheit, die gemeinsam mit dem Geruch von Zimt und Glühwein durchs Haus zieht. Und es ist jedes Jahr aufs Neue die Erkenntnis, dass anderen Menschen eine Freude machen, selbst die größte Freude ist. Dass wir alle ein bisschen das Leuchten füreinander sein können, nach dem wir uns das ganze Jahr gesehnt haben.

