Text: Anni Spörri I Kunst: © Lu Kohnen
Als Single fühle ich mich in meinem Freund:innenkreis oft unvollständig, so als würde mir ein Stück zu meinem Glück fehlen. Warum ist das so? Eine Abrechnung mit dem Konzept der «besseren Hälfte».
„Und? Gibt es da jemand Besonderen in deinem Leben?“, grinst mich eine Freundin beim gemeinsamen Kaffee an. Die Frage nervt mich. Wieso wird sie gleich nach einem kurzen Studium- oder Job-Update gestellt, lange bevor mein Gegenüber andere Bereiche meines Lebens erfragt? Die Frage ist vorwurfsvoll. Sie bäumt sich wie Edna „E“ Mode, die kleine, bebrillte Frau im Disney Film «The Incredibles», mit einem verzogenen Mund vor mir auf und verurteilt mich. So fühlt es sich jedenfalls an.
Dass immer nach meiner hypothetischen besseren Hälfte (ich finde diesen Begriff schrecklich) gefragt wird, gibt mir das Gefühl, nicht genug zu sein. So allein, nur ich. Als wäre ich unvollkommen, als fehlte mir ein Teil. Ein Teil, der mich nicht nur komplementieren, mein Leben zum Besseren verändern, sondern mich ganz generell erst zum Leben befähigen würde. Wie ein Schwimmreifen, ohne den ich untergehen würde.

Liebeskapitalismus
Die Welt, in der wir leben, ist für monogame Pärchen designt. Die kleinsten Tische im Restaurant sind gedeckt für zwei Personen, sodass sie sich verliebt in die Augen schmachten können. Der Hashtag #couplegoals wurde auf Instagram als Bildunterschrift für knapp 39 Millionen Fotos benutzt. Ob beim romantischen Wochenende in den Schweizer Bergen die Seele baumeln lassen oder Pullis in derselben Farbe tragen: zu zweit ist alles möglich und schöner.
Natürlich könnte man das auch mit Freund:innen tun. Ab einem gewissen Alter ist es gesellschaftlich aber schlichtweg nicht mehr akzeptiert, Single zu sein. Ganz besonders nicht als Frau. Denn es ist vorgesehen sich zu paaren, am liebsten im Einfamilienhaus, in dem man Grillfeste planen kann. Vorgelebt wird uns das von den älteren Generationen, von Filmen, von Musikvideos. Laut IMDb (Internet Movie Database) wurden 2019 970 Produktionen gedreht, die dem Genre «Liebesfilm» zugeordnet werden können. Dabei geht es um monogame Liebe, das versteht sich von selbst. Ganz wichtig dabei: die Hochzeit – der ja bekanntlich «schönste Tag im Leben einer Frau» (auch dieser Ausdruck – schrecklich).
Wie beliebt das Thema ist, zeigt sich auch bei einer Google-Suche: auf das Stichwort «wedding» finden sich rund 2’710’000’000 Treffer. In einem Artikel von 2017 schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dass die Hochzeitsbranche in Deutschland jährlich zwei Milliarden Euro Umsatz zu verzeichnen hat. In der Schweiz zeigt sich das gleiche Bild. Obwohl die „Heiratsstrafe“ – bundessteuerliche Benachteiligungen für Ehepaare höherer Einkommensklassen – immer noch aktuell ist, wurden hierzulande laut Statista 2019 knapp 39’000 Ehen geschlossen.
Mon(ey)ogamie
Von den Steuern einmal abgesehen, in der Schweiz spricht mensch sogar von der «Heiratsstrafe», sind verheiratete Paare aber in jeglicher Hinsicht privilegiert gegenüber unverheirateten. Sie sind die vom Kapitalismus gewünschte Form einer Bindung zwischen Menschen mit der daraus resultierenden Kernfamilie. Sie sind berechenbar.
Doch woher kommt dieser Druck, sich früher oder später «für die Ewigkeit» zu binden? Laut Friedrich Engels etablierte sich die Monogamie und später mit ihr die Ehe erst, als das Privateigentum aufkam [1]. Zuvor bestand nicht die Notwendigkeit, exklusive Partner:innenschaften zu führen. Mit dem Besitz konnte nun aber etwas vererbt werden, was die Frage nach den biologischen Erb:innen beziehungsweise dem biologischen Vater relevant werden ließ. Die Eheschließung, welche den Vater klar identifizierbar machte, diente der Kontrolle der weiblichen Sexualität.
Sie hält aber nicht nur patriarchale Strukturen aufrecht, sondern auch koloniale. George P. Murdock, ein US-amerikanischer Ethnologe, erforschte in den 1940-er Jahren die Sozialstruktur von 238 unterschiedlichen «urmenschlichen» Gemeinschaften [2]. Nur 43 davon lebten monogam. Er schloss daraus, dass vor der Kolonisierung der Welt durch den sogenannten «Westen» 80 % der Menschen polygyn lebten. Die deutsche Historikerin Gabriele Metzler kommt in ihrem Aufsatz «›Wir‹ und die ›Anderen‹. Europäische Selbstverständigungen» zu einem ähnlichen Schluss. Das Ideal einer heterosexuellen Zweierbeziehung beziehungsweise einer Kernfamilie sei in die Kolonien transferiert worden, um die dortige Bevölkerung moralisch zu «zivilisieren».
Sind wir heute noch Kugelmenschen?
Wieso sollten wir Menschen eine solch diskriminierende Institution wie die Ehe heute also noch aufrechterhalten wollen? Weder wirtschaftlich noch ideologisch gibt es dafür valide Gründe. Warum wir es dennoch tun, ist unserer Sozialisation geschuldet. Unsere ganze Alltagswelt zeigt uns, wie wir uns zu lieben haben. Wie weit diese Vorstellung einer binären Liebesbeziehung kulturell zurückgeht, zeigt eine der bekanntesten Liebeserzählungen der Antike.
Platon schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus die Geschichte der Kugelmenschen: im Symposion erzählt seine Figur Aristophanes von den kugelförmigen Vorfahren der Menschen. Jede Kugel besaß zwei Köpfe, vier Hände und ebenso viele Füße. Als Strafe, weil sie die Götter infrage gestellt hatten, wurden diese Kugelmenschen von Zeus entzweit. Weil jede:r ihre:seine (körperliche) Vollkommenheit verloren hatte, waren sie von da an nun auf der Suche nach ihrer (besseren) Hälfte, die sie wieder rund und vollkommen werden ließ.
Und so suchen wir heute noch nach dieser uns vervollständigenden Hälfte. Wie realistisch ist diese Vorstellung, den:die «Seelenverwandte:n» zu finden, wenn mensch nur lange genug sucht? Laut dem Verein Fachanwältinnen und Fachanwälte für Familienrecht nicht sehr: die Scheidungsrate lag in der Schweiz 2020 bei ungefähr 40 %. Wir alle verändern uns ständig, Liebgewonnenes wird irgendwann langweilig oder fremd. Warum sollte sich das bei Menschen anders verhalten?
Bier und Bussis
Anderer Meinung sind meine Freundinnen. Beim gemeinsamen Biertrinken sind in letzter Zeit die festen Freund:innen das allumfassende Gesprächsthema, zu Partys werden jetzt die Partner:innen mitgebracht. Die Paare sind verschmolzen. Die Einsgewordenen handeln als wandelndes Kollektiv. Sie trinken dasselbe, rapportieren brav das gemeinsam Erlebte, sie halten sich aneinander fest, als hätten sie ihren Gleichgewichtssinn verloren und mit einem flüchtigen Kuss im 10-Minuten-Takt wird sich eifrig die Liebe bestätigt. Sie könnte sich ja verändert haben. Es stört mich nicht, dass sie verliebt sind, es ist auch kein Neid. Es stört mich, dass einem vorgelebt wird, dass dieser Pärchen-Modus der einzig richtige sei.
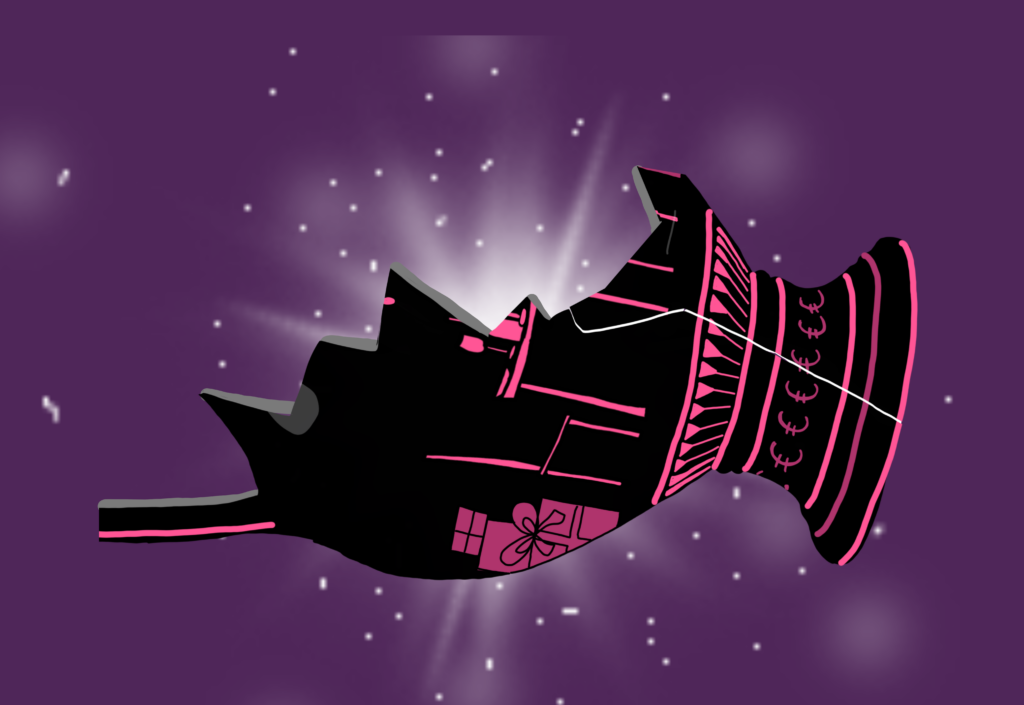
Puzzeln für Erwachsene
Meiner Meinung nach sehr treffend erzählt der schottische Comedian Daniel Sloss in der Episode «Jigsaw» seines Netflix-Specials «Daniel Sloss: Live Shows» von einer ähnlichen Erfahrung. Als Sloss sieben Jahre alt ist, fragt er seinen Vater nach dem Sinn des Lebens. Sloss Senior erklärt ihm diesen mithilfe einer Metapher. Jeder Mensch habe sein eigenes Lebenspuzzle. Weil alle ihre Puzzlebox verloren hätten und nicht mehr wüssten, wie das Bild zu vervollständigen sei, fange Mensch zunächst mit den Außenlinien des Puzzles an. Sie ergäben sich aus der Familie, den Freund:innen, den Hobbys und dem Beruf. Das Zentrum, das Allesverbindende des Puzzles, sei der:die Partner:in, sie:er verleihe dem Leben einen Sinn.
Wem dieser nicht platonische Lieblingsmensch also fehle, führe Sloss Senior zufolge ein sinnloses Leben. Die Person sei unvollendet und kaputt. Weil der Comedian eine derart krasse Abhängigkeit von einem anderen Menschen nicht akzeptieren möchte, stellt er ein neues, eigenes Modell auf. Er verändert das seines Vaters minimal, aber entscheidend: Das Puzzleteil, das wie Kerzenwachs ganz einfach ins eigene Leben gegossen wird, sich geschmeidig einfügt und alle Teile zusammen hält, muss nicht die «bessere Hälfte» sein. Es ist etwas, das den Menschen glücklich macht, sei es Modellflugzeuge bauen oder Erdbeeren pflücken. Für Daniel Sloss’ Vater ist dieses Bindeglied seine Frau. Für Daniel Sloss’ selbst ist es die Comedy.
Mein Bienenwachs
Für mich sind es immer wieder neue Dinge und Menschen: meine Freund:innen, liebgehörte Musik, Schreiben. Im Umkehrschluss bin ich nicht weniger komplett, weil das Bienenwachs in meinem Leben keine einzelne Person ist. Ich gerate dennoch immer wieder in Situationen, in denen ich mich wegen meines Beziehungsstatus weniger wertgeschätzt fühle. Wie ich damit umgehen soll, finde ich immer wieder schwierig. Mir helfen Bücher, die mir Liebe aus einer anderen Perspektive erklären wie beispielsweise «Radikale Zärtlichkeit» von Şeyda Kurt. Und es hilft, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Edna-«E»-Mode-Frage vielleicht in meinem Kopf sehr viel fieser und herablassender guckt, als sie gemeint war.
Weiterführende Lektüretipps
- Şeyda Kurt: Radikale Zärtlichkeit, HarperCollins 2021.
- Margarete Stokowski: Untenrum frei, Rohwolt 2018.
- Eva Illouz: Warum Liebe weh tut, Suhrkamp 2016.
- bell hooks: Communion, HarperCollins 2002.
- Christina Thürmer-Rohr: Fremdheiten und Freundschaften, Transkript 2019.
[1] Friedrich Engels: Family, Private Property and State, 1884.
[2] George P. Murdock: Social Structure. Free Press, London 1965.

