Diesen Sommer haben wir* die Gesprächsreihe „Mourn & Organize – Solidarität in reaktionären Zeiten“ veranstaltet. An drei Abenden haben wir verschiedene Menschen eingeladen und uns zusammen gefragt: Wie können wir handlungsfähig bleiben in einer politischen Gegenwart, die von Rechtsruck, Erschöpfung und Ohnmacht geprägt ist – und wo finden wir Räume für Hoffnung und Solidarität?1
*Wir, das sind Frida, Laura, Paul und Katha vom sai:kollektiv!
1. Gewerkschaftliches Handeln (23.06.2025)
Den Auftakt unserer Gesprächsreihe machte Nina, Kulturwissenschaftlerin und Organizerin aus Hamburg, die mit uns eine Reise durch die Geschichte der Arbeitskämpfe machte – von den wilden Streiks der 1970er Jahre bis hin zu den aktuellen Auseinandersetzungen um faire Löhne und Arbeitsbedingungen. Sie zeigte uns damit, wie kollektives Handeln nicht nur materielle Verbesserungen erkämpfen, sondern auch Räume für gegenseitige Unterstützung und politische Bildung eröffnen kann.
Nina erzählte von konkreten Kämpfe von Arbeiter:innen oder medizinischem Personal, in denen Beschäftigte trotz widriger Umstände gemeinsam Stärke entwickelten und Veränderung erkämpften. Die Methoden des Organizings, die auch in heutigen, insbesondere linken Wahlkämpfen prägend sind, boten uns Impulse für die anschließende Diskussion darüber, wie diese Erfahrungen für die Gegenwart und Zukunft genutzt werden können: Welche Formen kollektiver Organisierung brauchen wir heute – und wie können wir Solidarität praktisch und nachhaltig leben?
2. Künstlerisches Handeln (23.07.2025)
Bei unserer zweiten Veranstaltung rückten wir die politische Kraft von Kunst in den Mittelpunkt. Ana und Fabio vom Wiener Kollektiv state of matter stellten ihre Arbeit „We Wish You a Safe Ride“ vor – ein Projekt, das während der WIENWOCHE 2024 in Kollaboration mit dem RidersCollective entstand. Die künstlerische Intervention eröffnete Essenslieferant:innen Freiräume für Vernetzung, während Festivalbesucher:innen auf solidarischer Basis Arbeitsschichten der Fahrer:innen übernahmen.
So entstand nicht nur ein Raum der Entlastung, sondern auch ein spürbarer Perspektivwechsel: Wer sonst Essen bestellt, übernahm nun selbst die Rolle der Liefernden. Das Projekt machte damit sichtbar, wie Kunst soziale Realitäten verschiebt, Allianzen schafft und prekäre Arbeitsbedingungen in die Öffentlichkeit bringt. In der Diskussion wurde deutlich, dass künstlerische Strategien weit über symbolische Gesten hinausgehen können: Sie sind in der Lage, Solidarität zu konkretisieren und Strukturen aufzubrechen, die sonst unsichtbar bleiben.
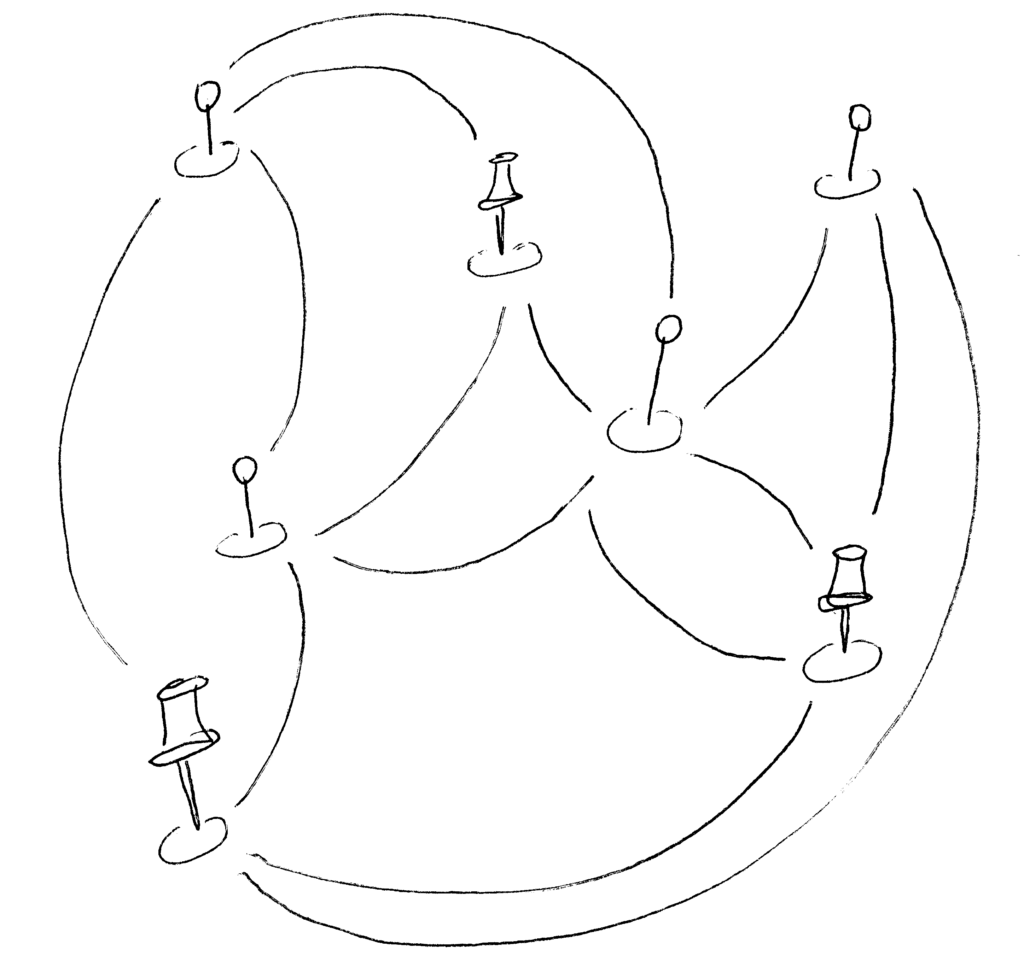
3. Interventionistisches Handeln (27.08.2025)
Zum Abschluss unserer Gesprächsreihe haben wir Isaak Rose eingeladen. Als Journalist, Jurastudent und Antifaschist erzählte er uns von seinen Erfahrungen auf hunderten Protesten gegen die extreme Rechte und die AfD. Er schilderte die Dynamiken, die entstehen, wenn sich Menschen gegen faschistische Mobilisierungen stellen und machte gleichzeitig auf die Risiken aufmerksam, die mit offenem – also unvermummtem – antifaschistischen Engagement verbunden sind.
Von staatlichen Repressionen, juristischen Konsequenzen bis hin zu Bedrohungen durch rechte Netzwerke wurde deutlich, dass Widerstand nicht ohne Kosten ist. Gleichzeitig machte Isaak klar, dass genau dieses Engagement unabdingbar bleibt: Antifaschistischer Kampf muss beharrlich fortgeführt werden – konstruktiv, wenn es darum geht, Bündnisse aufzubauen und solidarische Strukturen zu stärken, aber auch destruktiv, wenn es gilt, rechten Bewegungen aktiv entgegenzutreten und sie zu (zer-)stören. Gemeinsam diskutierten wir, welche Handlungsmöglichkeiten wir als Zivilgesellschaft haben, um dem Aufstieg von Rechtsextremen etwas entgegenzusetzen, welche Facetten Widerstand haben kann und wie wir im Kampf Mut und Ausdauer finden können.
Unser Fazit mit (großen!) Aussichten
Die drei Abende spannten einen Bogen von Arbeitskämpfen über künstlerische Interventionen bis hin zu antifaschistischen Aktionen. Gemeinsam machen sie deutlich: Solidarität hat viele Gesichter. Sie ist unbequem, kreativ, mutig – und gerade in reaktionären Zeiten wie heute unverzichtbar. Der Austausch hat uns auch gezeigt, dass wir weitermachen wollen und müssen.
Deshalb haben wir uns parallel zu den Talks organisiert und arbeiten zur Zeit fleißig an einem Zine, das den gleichen Namen tragen soll, wie unsere Veranstaltungsreihe: „Mourn & Organize – Solidarität in reaktionären Zeiten“.
Warum ein Zine? Weil wir damit ein unabhängiges, leicht vervielfältigbares Printprodukt an der Hand haben, das der reaktionären Gegenwart etwas entgegensetzt. Das Zine soll sichtbar machen, soll Raum bieten für Reflexion und Verbindung. Wir wollen uns umschauen und fragen: Welche Erfahrungen sind individuell, welche kollektiv – und was bedeutet das politisch? Neben Analysen, Tipps, Tricks und Kritik geht es uns auch um die Frage: Wie geht es uns und unseren Freund:innen gerade?
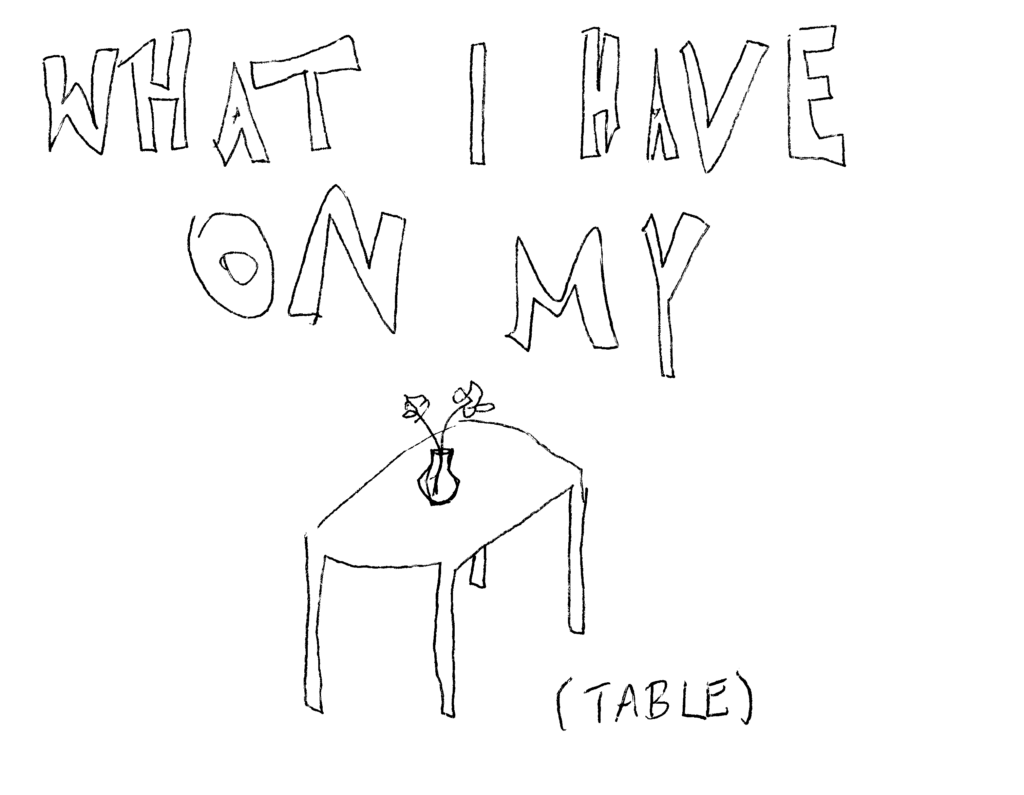
Ein Zine bietet dafür den richtigen Rahmen: zugänglich, kostengünstig, schnell verbreitbar. Damit knüpfen wir an die Tradition feministischer und linker Bewegungen an – als Werkzeug der Selbstermächtigung, als Ausdruck radikaler Subjektivität und kollektiver Erfahrung.
Wir wollen einen Raum schaffen für Theorie und Alltag, für Widersprüche und Resonanz. Das Zine ist Auftakt und Experiment zugleich. Und es kann und soll weitergetragen werden in weitere Veranstaltungsformate – Vorträge, Lesungen, Diskussionen –, in denen wir die Themen vertiefen und gemeinsam weiterdenken.
Mourn & Organize schlägt einen Arbeitsprozess vor um den Rückschritt nicht mitzugehen, sondern solidarische, kämpferische und nachhaltige Strategien zu sammeln. Für ein anderes Normal. Für eine bessere Zukunft. Für Alle.
- Dieses Projekt hätten wir ohne Unterstützung bei weitem nicht so realisieren können, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir bedanken uns deshalb ganz herzlich bei kulturweit für die Förderung und die damit ermöglichte Umsetzung unserer Ideen! ↩︎

